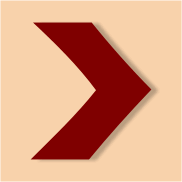Aach Gude - Rheingauer Wörterbuch
„Jede Mundart ist Volksmundart, heimlich und sicher, aber auch unbeholfen und unedel, dem bequemen Hauskleid, in welchem nicht ausgegangen wird, ähnlich. Im grunde sträubt sich die schämige Mundart wider das rauschende Papier, wird aber etwas in ihr aufgeschrieben, so kann es durch treuherzige Unschuld gefallen.“
Joseph Kehrein, Volkssprache und Wörterbuch von Nassau, Zitat aus dem Vorwort
Nit nur für Haargeloffene!
Reichen die Wurzeln der Heimatsprache, wie Hedwig Witte in einem Gedicht sagt, immer noch „dief in de Boddem“ wie Rebwurzeln? Wir haben inzwischen von den Geisenheimer Forschern gelernt, dass die Rebe da, wo sie ausreichend Wasser in Oberflächennähe findet, gar nicht so tief wurzelt. Was die Sprache angeht beobachten wir, dass immer weniger Menschen im Rheingau von Klein auf das sprechen lernen, was wir Mundart nennen - auf gut Griechisch „diálektos“ - von légein „sprechen“ und día „auseinander, anders". Unsere Kinder lernen die Mundart bei der Fassenacht und bei den „Schlappmäulcher“ unseres Mundartvereins wie eine Fremdsprache. Die Vielen, die im Rheingau vorübergehend oder dauerhaft „zuziehen“ sind mit eigenen Mundarten, mit der Hochsprache oder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch aufgewachsen. Sprache ist etwas Lebendiges. Sie entwickelt sich weiter mit denen, die sie sprechen. Wie viele Sprachen sind mit den Sprecherinnen und Sprechern ausgestorben!Kennen Sie die ...?
Hier werden einige durch Zufall ausgewählte Begriffe angezeigt.
eninn, erinn
Umstandsworte, i betont, auch eninnzus, erinnzus, allg. für hinein, herein. Der Anhang -zus, mit langem u, steht verstärkend für die Richtung; vgl. ewegg.
Nabbelreiber
der, a kurz und betont, derb für Tanz, bei dem sich das Paar eng umschlungen hält.
Kannebee
das, Pl. selten, a kurz und betont, allg. für Sofa; frz. canapé, was freilich auch Schnittchen heißen kann.